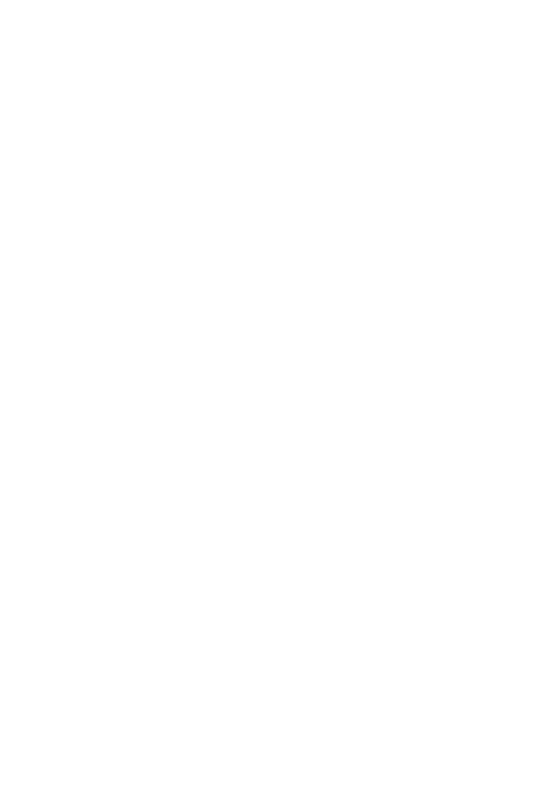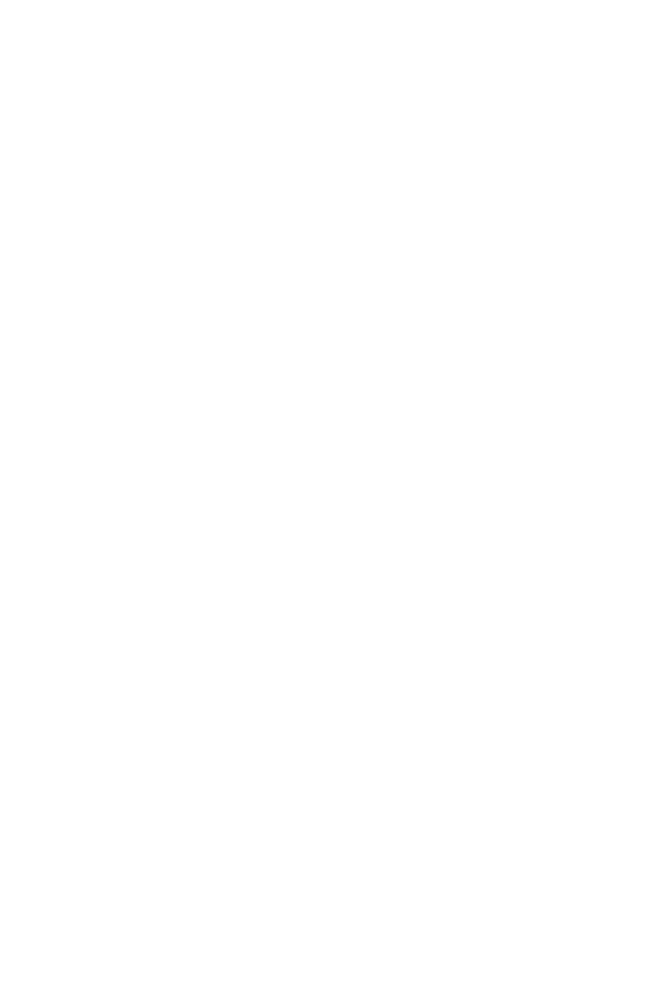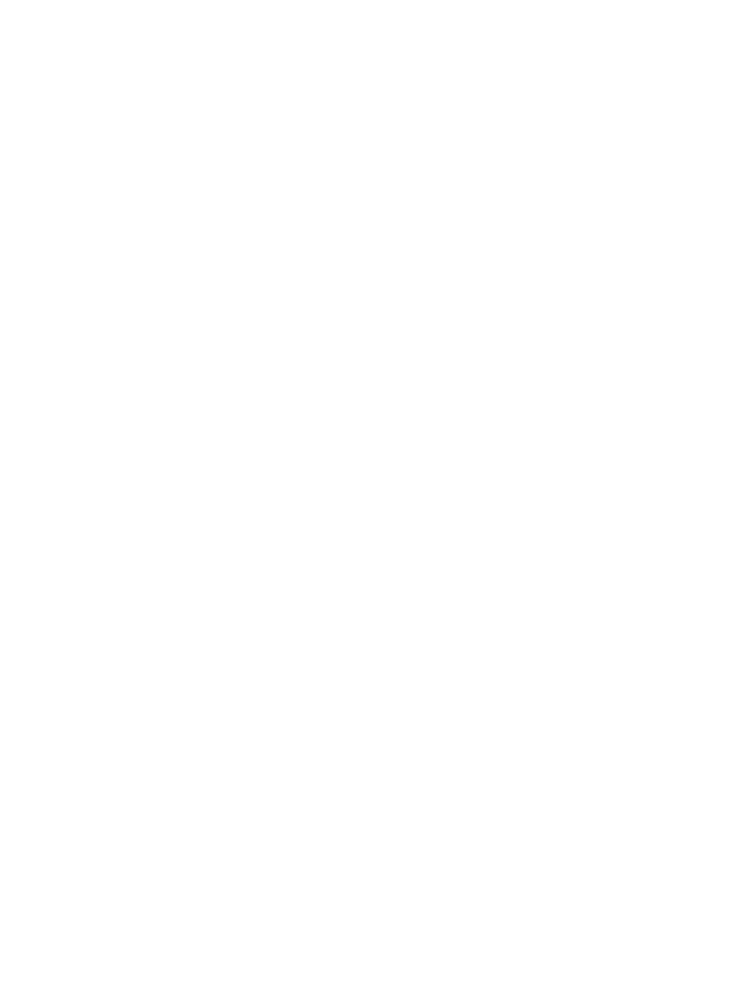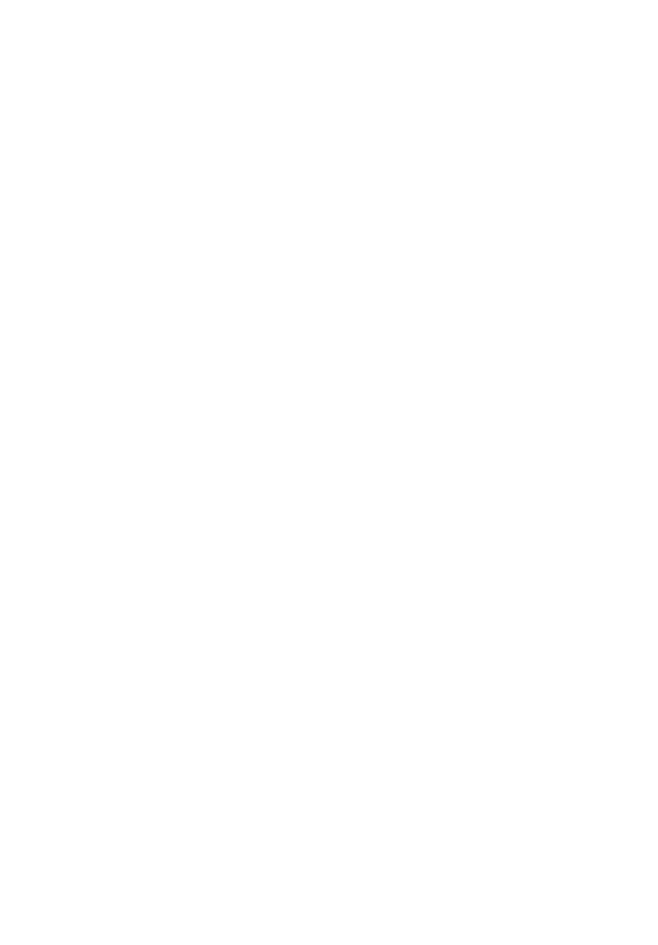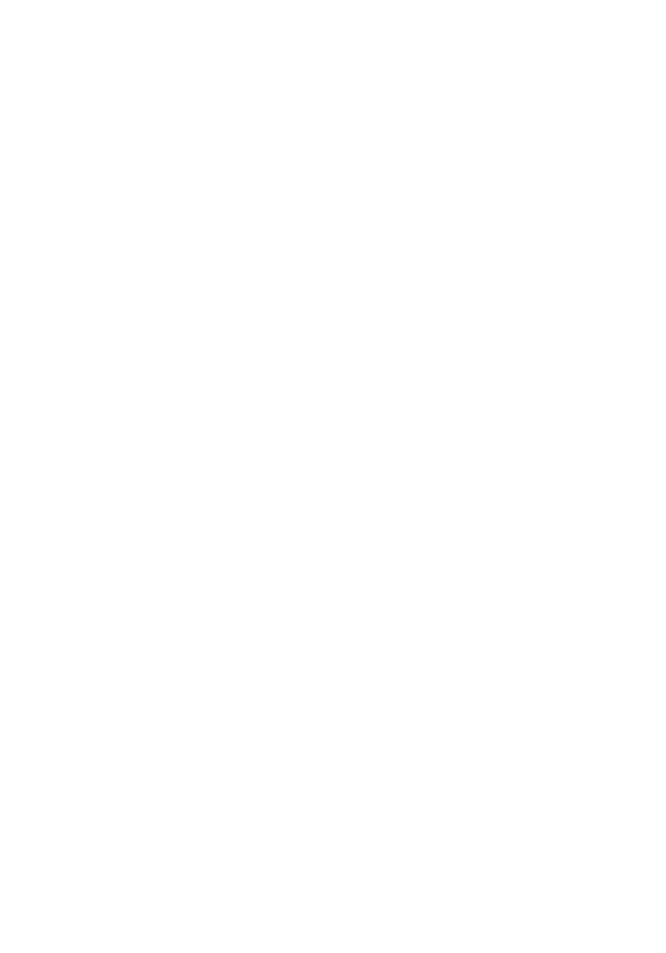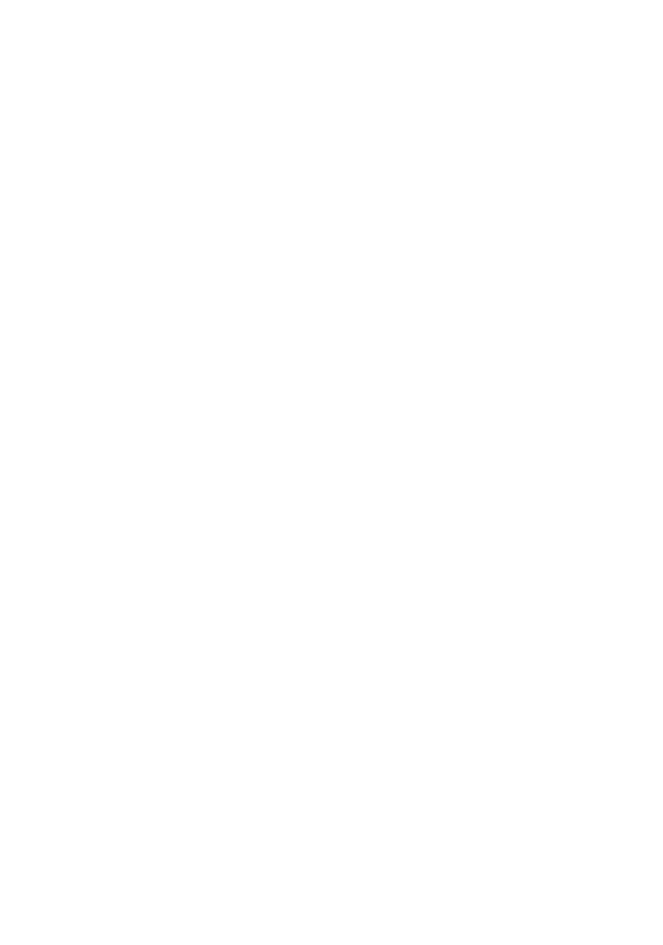Die Axiome der religiösen Erfahrung
Kommentierte Ausgabe
В июле 2025 года в Германии в издательском доме «Hagia Sophia» (серия Philosophia Eurasia) вышел прокомментированный перевод на немецкий язык фундаментального труда русского философа И.А. Ильина «Аксиомы религиозного опыта» !
Книга вышла под основным названием «Philosophie der Religion» - именно такое название было дано философом будущей работе с момента начала её подготовки, то есть с 1918-1919 годов. Завершено исследование было в 1951 г., опубликовано только в 1953-ем.
Как оказалось, при жизни Ильин сам собирался издать свою книгу на немецком языке. В архиве мыслителя сохранились папки с переведёнными главами, но, увы, до сегодняшних дней на немецком книга не издавалась.
Мне довелось немного помочь инициатору и издателю перевода книги проф. Andorján Kovács, благодаря которому осуществилось задуманное Ильиным. По завершению подготовки перевода книги, узнав о том, что в архиве Ильина уже имелся вариант работы на немецком (перевод по какой-то причине не был одобрен И.А.), проф. Kovács занялся сравнением получившегося перевода с «авторским», что нашло своё отражение в комментариях к изданию. Также удалось искоренить досадную опечатку, которая повторяется из одного русского варианта работы в другой.
Когда prof. Andorján Kovács поделился со мной сомнениями издательства касательно того, что книга из-за своего объёма и стоимости может не слишком-то пользоваться спросом, я указала на то, что в любом случае – это прекрасный вклад в вечность. Интересно, что одно из первых газетных объявлений, анонсирующее выход «Аксиом» в 1953 г., информировало читателей о том, что «книга издаётся группой её друзей не из коммерческих, а из чисто идейных побуждений».
Первые русские читатели при знакомстве с «Аксиомами...» Ильина практически как один повторяли то, что книга является «прекрасным пособием и руководством для хотящего и ищущего истин веры, познания основ веры, пособием найти веру и научиться ей», что было вполне актуально для человечества второй половины XX века. Как мне кажется, не теряет актуальности этот труд и в наше время.
Поздравляю инициатора издания и комментатора книги prof. Andorján Kovács, а также издательский дом «Hagia Sophia» с их серией «Philosophia Eurasia», которые уже не первый год знакомят немецкоязычную публику с творчеством Ивана Ильина и иных русских мыслителей!
Ниже, с любезного разрешения prof. Andorján Kovács, можно ознакомиться с предисловием, введением и примечаниями издателя, которые помещены в немецком варианте книги.
Приобрести книгу можно осуществив заказ на сайте издательства «Hagia Sophia» https://www.edition-hagia-sophia.de/p/iwan-iljin-philosophie-der-religion/
In Deutschland ist Iwan Iljin weitgehend un bekannt, in Russland hingegen gilt er als einer der bedeutendsten politischen, philo sophischen und religiösen Denker des 20. Jahr hunderts. Bis zu dieser Wahrnehmung und Aner kennung war es jedoch ein weiter Weg. In seiner akademisch aktiven Zeit in Russland (1906-1922) hinterließ er schon erste Spuren, aber in der Sow jetunion waren seine Werke, in denen Iljin keinen Zweifel an seiner entschiedenen Ablehnung des Bolschewismus ließ, verboten.
Erst nach 1990 bekam er die ihm zustehende Aufmerksamkeit in seiner Heimat, die immer Mittelpunkt seiner gedanklichen und emo tionalen Welt blieb. Seit 2005 ist dabei leider auch eine zunehmende politische Instrumentalisierung seiner Person und seiner Lehren er kennbar – in Ost und West. Um diese selektive und zum Teil verfäl schende Interpretation der Ideen Iljins korrigieren zu können, muss man seine Werke im Original lesen und sich ein eigenes Bild machen. Dank der Bemühungen von Adorján Kovács und Gregor Fernbach erscheinen seine Werke nun sukzessive in der Edition Philosophia Eu rasia in deutscher Sprache.
Iwan Iljin hatte bereits früh mehrere Berührungspunkte mit der westlichen Philosophie und Gedankenwelt. So unternahm er in jun gen Jahren eine ausgedehnte Forschungsreise nach Deutschland, Frankreich und Italien. Im Mittelpunkt seiner akademischen Inter essen standen die Werke und Ideen Hegels, wobei er sich auch mit Schelling, Fichte, Rousseau, Aristoteles und Platon beschäftigte. Doch die angestrebte akademische Karriere konnte er in Russland nicht ver wirklichen, die Oktoberrevolution erwies sich als radikale Lebenszäsur. Seine entschiedene Ablehnung des Bolschewismus und seine Un terstützung der Weißen im Bürgerkrieg setzte ihn den Repressionen der neuen Machthaber aus. Angesichts mehrmaliger Verhaftungen und seiner Verurteilung zum Tode konnte er sich glücklich schätzen, 1922 mit dem sogenannten „Philosophenschiff“ die Sowjetunion zu verlassen. Die anschließende Zeit in Deutschland war geprägt von sei ner Tätigkeit am „Russischen Wissenschaftlichen Institut“ und einer regen Aktivität als Publizist und Vortragsredner.
In der Emigration vertrat Iljin konservative Positionen, denn er sah die Russen als kulturbildendes und daher zu Recht dominantes Volk, das paternalistisch die Nachbarvölker entwickeln sollte. Beson ders galt dies für seine Überzeugung eines gemeinsamen, untrennba ren Kultur- und auch Staatsraums von Russland, Ukraine und Bela rus. Diese These ist in Russland auch heute weit verbreitet. Iljins primäre Gegner blieben jedoch Kommunismus und Bolsche wismus. Gegen sie hielt er auch gewaltsamen Widerstand nicht nur für gerechtfertigt, sondern als Kampf gegen die Feinde der göttlichen Ordnung sogar für verpflichtend [1]. Allerdings widersprach er der in weiten Teilen der Emigration verbreiteten reaktionären Denkweise, denn er sah keine Chance für eine Restauration der alten politischen und sozialen Ordnung in Russland. Als Hauptursache des Bolsche wismus sah er nicht politische oder ökonomische Gründe, sondern eine tiefe spirituelle und religiöse Krise. Nur mit einer grundlegenden Selbstreflexion und Neuausrichtung konnte für ihn die notwendige Wiedergeburt gelingen. Auch die russische Philosophie sollte ihren Beitrag dazu leisten, sich dafür jedoch von den bisherigen westlichen Vorbildern lösen, sich erneuern und dabei auf ihre spezifischen, kul turellen Wurzeln und Erfahrungen besinnen [2].
Iljin war unbestreitbar Teil der Renaissance der russischen religi ösen Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhundert, die verbunden ist mit Namen wie Sergej und Evgenij Trubezkoj, Sergej Bulgakov, Pavel Florenskij und Nikolaj Berdjaev. Allerdings entwickelte er, ausgehend von seiner frühen und intensiven Beschäftigung mit Hegel, ein ganz eigenständiges Konzept der Erkenntnis und Erfahrung. Beide können für ihn, analog dem „Kulturrelativismus“ seines Zeitgenossen Franz Boas, nicht unabhängig gedacht werden vom jeweiligen kulturellen Kontext. Diese These ist ein wichtiger Bestandteil seiner Philosophie insgesamt und unverkennbar auch in den Axiomen der religiösen Er fahrung, deren deutsche Übersetzung nun vorgelegt wird.
Nach der Machtergreifung der NSDAP 1933 lehnte Iljin die Forde rungen der neuen Machthaber nach einer antisemitischen Position in seinen Vorlesungen entschieden ab. Dies führte 1934 zu seiner Entlas sung und 1938 zu einem Publikations- und Auftrittsverbot, woraufhin er sich zur Flucht in die Schweiz entschloss. Hier lebte er bis zu seinem Tode 1954, hier stellte er 1953 auch die Axiome der religiösen Erfahrung fertig. Dieses letzte zu Lebzeiten Iljins erschienene Werk besteht aus 27 Kapiteln, am Ende enthalten sie jeweils ausführliche Anmerkungen und Literaturhinweise. Daran sieht man, wie wichtig ihm war, den Le ser so nah wie möglich an dieses Thema heranzuführen, das ihn den Großteil seines Lebens beschäftigt hatte. Denn die Entwicklung des persönlichen geistig-religiösen Potenzials sieht er als wichtigste Auf gabe jedes Menschen und diese These zieht sich durch alle seine Wer ke. Gemeint sind dabei wohlgemerkt nicht instinktive oder empirische Erkenntnis, sondern das richtige Verständnis von der Bezogenheit der eigenen Existenz auf Gott. Nach Iljins Überzeugung kann der Mensch nicht ohne irgendeinen Glauben leben, für ihn liegt dies in der mensch lichen Natur. Der Glaube wiederum hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere inneren Einstellungen und auch unsere Handlungen [3].
In den Axiomen beschäftigt er sich zwar mit anderen Kulturen und Religionen [4], er betont aber die Bedeutung der jeweils eigenen kultu rellen Wurzeln. Für ihn hat gerade die Entfremdung von den eige nen Wurzeln und kulturellen Identität im modernen Menschen die ursprüngliche innere Einheit aufgelöst und zu einer Spaltung in Ver stand und Gefühl/ Herz geführt. Die von Iljin formulierten Axiome sollten jedoch nicht als Russland-spezifisch missverstanden werden, denn für ihn waren sie allgemeingültig, weil er die Orthodoxie als höchste geistige Entwicklungsstufe, als größtmögliche Annäherung an Gott ansah.
Er hält es für absolut evident („očevidnost“ ist еiner seiner zentra len Begriffe), dass die religiöse Wahrheit eigentlich jedem Menschen qua Natur innewohnt, jedoch seien wir in unserem traurigen Zustand blind dafür [5]. Um religiöse Erfahrung möglich zu machen, muss der Verstand mit dem Glauben in Einklang gebracht werden. Notwendig ist eine verbindende Klammer und das ist für Iljin das Erkennen mit dem Herzen („serdečnoe sozercanie“)[6]. Im Fehlen dieser Klammer, in der falschen Annahme, dass Verstand und Herz/ Gefühl unvereinbare Gegensätze sind, sah Iljin einen der Hauptgründe für die weltweite spirituelle Krise, für Revolution und Zerstörung. Die Versöhnung die ser beiden Elemente war nach seiner Überzeugung unbedingte Vor aussetzung für eine Wiedergeburt der individuellen Religiosität sowie der – nicht nur russischen – Staatlichkeit und Kultur insgesamt [7]. Da her wollte er selbst schon die Axiome auch auf Deutsch zugänglich machen, was ihm nicht mehr gelungen ist.
Allgemein entsteht Erkenntnis für Iljin nicht aus empirischen Sin neseindrücken wie bei David Hume oder als bloße neurobiologische Konstruktion des Gehirns wie bei Gerhard Roth. Vielmehr baut er seinen Ansatz auf übereinstimmende, allgemeingültige Lehren der Heiligen Kirchenväter auf, was Parallelen zur Neo-Patristik von Georgij Florovskij und Ioann Meyendorff erkennen lässt. Dazu zählen Spiritualität, Einheit / Unteilbarkeit des Glaubens [8], Erkennen mit dem Herzen / der Intuition, religiöse Reinigung, Demut, Gegenständlich keit, Verantwortung, nüchterne Betrachtung, Autonomie und Kreati vität. Diese Axiome sind für ihn notwendige, überzeitliche Kriterien für die einzig wahre Religiosität, allerdings kein dogmatischer Beweis, sie wirken auf einer spirituellen Ebene. Je größer die Annäherung an diese Axiome, desto stärker und tiefgründiger kann der Mensch sei nen Glauben realisieren [9].
Religiöse Erkenntnis gelingt für Iljin auch nicht durch abstraktes Philosophieren über Metaphysik oder den Geist Gottes, wie es heu te verbreitet ist, entscheidend sind für ihn persönliche Erfahrungen. Gleichzeitig begrenzen Subjektivität und Einzigartigkeit jedes persön lichen Glaubensweges die Erkenntnis der religiösen Wahrheit, die nur auf einer spirituellen Ebene gelingen kann. Aber echte Erneuerung, ein Leben nach den Prinzipien der christlichen Nächstenliebe und das demütige Streben zur Vollkommenheit und zum Glauben öffnen dem Menschen diesen Weg. In der Religiosität und einer inneren Ausrich tung auf Gott nähert sich der Mensch für Iljin seiner Bestimmung, seiner Gottähnlichkeit aus der Schöpfung [10]. Dieser Prozess ist von Sy nergie geprägt, von einem Zusammenwirken zwischen der göttlichen Offenbarung und ihrer freiwilligen, mehr noch − bereitwilligen An nahme durch den Menschen. In seiner anschließenden Hinwendung zu Gott findet der Mensch schließlich seine wahre Freiheit [11].
Iwan Iljins Axiome der religiösen Erkenntnis sind ein wertvoller Beitrag zur langen Tradition der russischen Religionsphilosophie, allen an dieser Thematik Interessierten bietet die Lektüre zweifellos einen hohen Erkenntnisgewinn. Aber es gibt durchaus Gründe, sie nicht nur aus wissenschaftlichem oder literarischem Interesse heraus zu lesen, Iljin kann uns mit seinen Thesen auch bei aktuellen Frage stellungen wichtige Inspiration geben. Denn er beschäftigt sich mit Kants bis heute relevanten, zentralen Fragen des Menschseins: „Was kann ich wissen?“ (Erkenntnis), „Was darf ich hoffen?“ (Religion), „Was soll ich tun?“ (Ethik).
Was aber, wenn man diese drei Fragen auf die heutigen westlichen Gesellschaften anwendet? Dann wird deutlich, dass der mit Aufklä rung und Säkularisierung begonnene Weg letztendlich in die Über zeugung mündete, dass religiöser Glaube irrational und nicht Gott Ursprung jeder Moral ist, sondern der Mensch selbst sich moralische Regeln vorgeben kann. Iljin möchte diesem Werterelativismus, den er in aller Klarheit als gefährlichen Irrweg erkannt hat, etwas entgegen stellen, denn für ihn muss der Glaube im Zentrum jedes Individuums und der Gesellschaft als Ganzes stehen [12]. Für dieses Ziel entwickelt er in den Axiomen eine neue, alternative Idee ‒ unverrückbare, univer selle, überzeitliche Fixpunkte, die uns bei der Suche nach allgemein gültigen Werten und auch echter Spiritualität helfen können. Beson ders wertvoll sind sie in aktuellen Diskursen, z. B. über eine christliche (?) „Leitkultur“, universelle Menschenrechte oder den „Kulturimperi alismus“ der Globalisierung. Das Lesen von Iwan Iljins Axiomen der religiösen Erfahrung ist nach meiner Überzeugung aus mindestens vier Gründen lohnens wert. Zum einen ermöglicht es den Einblick in die Gedankenwelt ei nes wichtigen Vertreters der russischen Religionsphilosophie. Ebenso f indet jeder, der nach spiritueller Erkenntnis und Vervollkommnung strebt, in diesem Werk wertvolle Anregungen. Weiterhin kann Iljin seiner russischen Heimat einen Gegenpol zu moralischem Verfall und offiziöser Kirche aufzeigen ‒ echte Wertorientierung und tiefe Religi osität. Zuletzt haben aber auch wir die Möglichkeit, aus seinen Ideen Orientierung zu schöpfen, einen festen Wertemaßstab in unserer heu tigen, so ambivalenten Welt.
Denis Jdanof
[1] In seinem bekanntesten Werk Über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse (1926), das bereits bei Philosophia Eurasia erschienen ist, sieht er darin keinen Wi derspruch zur orthodoxen Moral. Er betont aber, dass Gewalt für einen Christen im mer nur als Reaktion auf die Unvollkommenheit des Menschen gerechtfertigt ist. Es bleibt etwas Negatives, weil Gewalt das Böse nicht in etwas Gutes verwandelt, son dern es nur einhegen kann. Ihr Einsatz könne aber notwendig sein und sogar eine Pflicht darstellen, wenn allein dadurch größeres Leid verhindern werden kann: „Das radikale Böse, das in den Menschen lebt, triumphiert so lange, bis es gezügelt und festgehalten wird“ (Über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse, Wachtendonk 2018, S. 232).
[2] Die Grundlinien dafür skizzierte er 1937 in Der Weg der geistigen Erneuerung (Putʹ duchovnogo obnovlenija, deutsche Version: Die ewigen Grundlagen des Lebens, 1939, überarbeitete Neuauflage Wachtendonk, 2022), in dem er auch das Thema der religi ösen Erfahrung behandelte, und 1948-1955 in Unsere Aufgaben (Naši zadači).
[3] „Der Glaube […] ist der ausschlaggebende und leitende Lebenshang des Menschen, der sein Leben, seine Anschauungen und sein Trachten bestimmt.“ (Die ewigen Grundlagen des Lebens, Wachtendonk, 2022, S. 15).
[4] „»Die Liebe zur Vollkommenheit« ist nicht ein leeres Wort, affektierte Phrase oder sentimentale Einbildung, sondern lebendige Realität und dabei die größte bewegende Kraft des menschlichen Geistes und der menschlichen Geschichte. […]. Alle Stifter der großen geistigen Religionen — Konfuzius, Laozi, Buddha, Zoroaster, Moses wur den von diesem Gefühl bewegt. Dem Christen aber reicht es aus, das Evangelium zu öffnen und es zu lesen zu beginnen, um sich davon zu überzeugen, dass alle, die im Glauben sich an Christus gewandt haben, ihn durch den Strahl dieses Gefühls erkannten.“ (Axiome/Kapitel 5/Unterkapitel 2, S. 94. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die im Haupttext in eckiger Klammer aufgeführten Seitenzahlen des russischen Ori ginals).
[5] 1957 erschien posthum Der Weg zur Evidenz (Putʹ k očevidnosti) mit seinen Haupt thesen zu diesem Thema.
[6] „Das Heilige öffnet sich nur dem geistigen Auge und zwar gerade dem Auge des Her zens. Es öffnet sich weder der körperlichen Wahrnehmung noch dem begreifenden Verstand noch der spielenden oder schaffenslustigen Vorstellungskraft noch dem lee ren, wenn auch in seiner Sturheit ungestümen Willen. Deswegen kennt derjenige, der des geistigen Auges entbehrt, dessen Herz zum Schweigen gebracht worden ist, nichts Heiliges und kann dem Nihilisten nichts entgegnen. […] Die gottlose Seele ist kraftlos vor dem Andrang des echten Übels; sie ist hilflos im Kampf gegen den Teufel, denn der Teufel ist der treue »Ideologe« der Gnaden-, Ideen- und Schamlosigkeit.“ (Axiome/Kapitel 2/Unterkapitel 5, S. 46f.); „Ein schreckliches Unheil hat die zeit genössische Menschheit heimgesucht: Sie [die Menschheit] zerrüttete die geistigen Grundlagen ihrer Existenz, erstickte in sich die hauptsächliche religiös-schöpferische Kraft des Geistes — die Kontemplation des Herzens — und verlor ihre Heiligtümer. Infolgedessen stirbt das heilige Herzstück ihrer Kultur; ihr Leben wird zwecklos; ihre Schöpfungstätigkeit verliert ihre höchsten Ziele.“ (Axiome/Kapitel 2/Unterkapitel 5, S. 45).
[7] In dieser Position ist er dem orthodoxen Mönch Theophan dem Klausner sehr nah, der von „Schleiern“ gesprochen hatte, die die Erkenntnis der Wahrheit verhindern: „Zuallererst entferne von den Augen deines Geistes die Schleier, die seine Blindheit bewirken“ (Hl. Theophan der Klausner, Der Weg zur Erlösung, Simferopol, Verlag Rodnoe Slovo, 2017, S. 70); Iljin zitiert diesen Gedanken von Theophan zu Beginn seines Werkes Der Weg der geistigen Erneuerung [Iljin I. A., Der Weg der geistigen Erneuerung, in: Gesammelte Werke in 10 Bänden. Band 1. Moskau: Russisches Buch, 1993, S. 41] und auch in den Axiomen (Vorwort, S. 11).
[8] „Der Mensch [ist] nur dort religiös, wo er ganz ist und nur insofern, als es ihm ge lungen ist, innere Einheit und Einigkeit in sich selbst zu erreichen. Wer Gott nur mit einem Teil der Seele und des Geistes anerkennt und mit dem anderen oder mit den anderen — nicht anerkennt, hat seine geistige Katharsis noch nicht beendet. Er blieb am Scheideweg stehen und hat keinen Grund, sich als religiöser Mensch zu betrach ten.“ (Axiome/Kapitel 18/Unterkapitel 1, S. 366).
[9] „Es ist bemerkenswert, dass die russische Sprache dem Begriff »Glaube« zwei ver schiedene Bedeutungen gibt: die eine assoziiert den Glauben mit der Notwendigkeit, auf etwas zu vertrauen, die andere mit der Fähigkeit zu glauben. Auf etwas vertrau en tun alle Menschen, bewusst oder unbewusst, böswillig oder gutmütig, stark oder schwach. Aber glauben tun bei weitem nicht alle: Denn Glauben setzt im Menschen die Fähigkeit voraus, sich mit der Seele (Herz und Wille und Taten) mit dem zu ver binden, was wirklich Glauben verdient, was dem Menschen in der spirituellen Er fahrung gegeben wird, was ihm einen bestimmten »Heilsweg« eröffnet. Auf Karten, Träume, Wahrsagerei, astrologische Horoskope – vertraut er; aber an Gott und an alles Göttliche - glaubt er.“ [Iljin I. A., Der Weg der geistigen Erneuerung, in: Gesam melte Werke in 10 Bänden. Band 1. Moskau: Russisches Buch, 1993, S. 49; ähnlich in Die ewigen Grundlagen des Lebens, S. 22].
[10] „Die echte Offenbarung besteht darin, dass Gott den Menschen zu sich — durch die Fülle der geistigen Freiheit zu der Fülle der Einheit mit Ihm — ruft.“ (Axiome/Kapitel 2/Unterkapitel 4, S. 44)
[11] „Von Gott geht die geistige Offenbarung aus, die vom Menschen frei und ganzheitlich angenommen werden muss. Vom Menschen aber geht die lebendige, unerzwungene und aufrichtige Annahme (durch Kontemplation, Liebe und Glaube!) aus, die zu Gott in Form des Gebetes und der Taten, die dem Gebet entsprechen, aufsteigt“ (Axiome/ Kapitel 3/Unterkapitel 1, S. 49).
[12] „Weil ohne Gott - verliert die gesamte Kultur der Menschheit ihren Sinn und ihre Bedeutung“ [Iljin I. A., Der Weg der geistigen Erneuerung, in: Gesammelte Werke in 10 Bänden. Band 1. Moskau: Russisches Buch, 1993, S. 357; siehe auch Die ewigen Grundlagen des Lebens, S. 43f.].
Die Axiome der religiösen Erfahrung ist das grundlegende Werk des russischen Denkers I. A. Iljin (1883-1954), das er kurz vor seinem Tod, der am 21. Dezember 1954 erfolgte, fertigstellte und veröffentlichte. Im Vor feld seines Todes bedauerte der Philosoph, dass viele der von ihm begonnenen Bücher aufgrund der schwierigen Lebensumstände, in denen er sich befand, nie vollendet wurden: drei Revolutionen in Russland, erzwungene Ausweisung aus dem Land mit Verbot der Rückkehr in die Heimat, „Revolution“ in Deutschland mit anschlie ßendem Verbot der Arbeit russischer Wissenschaftler in diesem Land, erzwungene Flucht in die Schweiz, wo er sein Leben neu aufbauen musste, indem er mit Schreiben und Vorträgen Geld verdiente. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Buch Die Axiome der religiösen Er fahrung trotz alledem 1951 im Wesentlichen fertiggestellt und heraus gegeben wurde (veröffentlicht 1953 [1]), und dass die Arbeit an dieser Studie 1919 in Moskau begonnen wurde, als der Bürgerkrieg bereits im Lande tobte. Was veranlasste den Philosophen, eine scheinbar weit entfernte Frage aufzugreifen und eine groß angelegte Studie in Angriff zu nehmen, die in dem in den Archiven aufbewahrten Entwurf den Titel „Philosophie der Religion“ (der für die vorliegende Übersetzung beibehalten wurde) trägt?
Tragische Zeiten bringen uns immer dazu, über das Ewige und Un vergängliche nachzudenken, über das, was nach I. A. Iljin das Kriterium des menschlichen Lebens auf der Erde ist, das heißt, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Schon in der Emigration stellten russische Denker fest, dass sie in den nachrevolutionären Jahren in Russland eine kontinuierliche geistige Arbeit hatten, die den bereits in Europa ansäs sigen russischen Flüchtlingen vorenthalten wurde. Erwähnenswert ist die Ende 1922 in Berlin eröffnete Religiös-Philosophische Akademie, ein Projekt von N. A. Berdjaew (das ihrem Gründer nach 1924 nach Paris übersiedelte), an deren Aktivitäten anfangs neben Iljin auch S. L. Frank, B. P. Wischeslawzew, L. P. Karsawin, F. A. Stepun und ande re teilnahmen. Im Rahmen von Kursen und Treffen an der Akademie wurden Fragen der Religion und Religiosität lebhaft diskutiert. Die Re ligiös-Philosophische Akademie knüpfte an die Diskussionen an, die frühere russische Denker, die aus dem Land vertrieben worden waren, in den Mauern der Freien Akademie für geistige Kultur (1919-1922) in Moskau geführt hatten. Im Großen und Ganzen war der Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland bis zu dem berüchtigten Ereignis, das als „Philosophendampfer“ bezeichnet wurde, eine Zeit der blü henden, aber bereits dekadenten, von der Sphäre des Geistes losgelös ten und im Niedergang befindlichen Kultur. In dieser Zeit entstanden einzigartige philosophische Konzepte, und viele Werke nicht nur der Klassiker, sondern auch von Zeitgenossen wurden recht schnell aus europäischen Sprachen ins Russische übersetzt. Diese Zeit wurde zwar in der Literatur als „Silbernes Zeitalter“ bezeichnet, doch im Bereich der Philosophie könnte man sie durchaus als „Goldenes Zeitalter“ des russischen philosophischen Denkens bezeichnen. Zu Beginn des Jahr hunderts waren die intellektuellen Eliten sowohl in Russland als auch im Westen voll von geistiger Suche und Versuchen, einen Ausweg aus der Krise zu finden, in der sich die europäische und organisch ver wandte russische Philosophie befanden. Positivismus und Materialis mus, die im Zusammenhang mit der Abkehr der gebildeten Schichten vom religiösen Glauben und den Erfolgen auf dem Gebiet der Natur wissenschaften in die Sphäre des humanitären Wissens eindrangen, wurden zunehmend von scharfer Kritik und Ablehnung des philoso phischen Fideismus und Idealismus begleitet. Ihnen wurde faktisch die Existenzberechtigung abgesprochen, ganz zu schweigen von der damit verbundenen Sphäre der Religion und der Theologie, die zuneh mend aus der Weltanschauung, aus der Erforschung der Wirklichkeit ausgeschlossen und faktisch aus der Klammer der wissenschaftlichen Denkweise herausgenommen wurden. Der Bruch mit dem Idealismus, der sich seit der Scholastik auf rein abstrakte Argumentationstheorien und die Zusammenstellung verschiedener Tabellen und Schemata re duziert hatte, und die Reduzierung der Theorie auf die Identifizierung und das Verständnis von Ursache-Wirkungs-Beziehungen auf der Grundlage empirischer Fakten ließen jedoch die Kluft zwischen rea lem und geistigem Leben immer größer werden. In diesem Bruch und der Ablehnung des geistigen Lebens, die die aus Russland vertriebe nen Philosophen als „Krise der geistigen Kultur“ bezeichneten, wurde schließlich die Ursache für all die Katastrophen gesehen, die Russland und die ganze Welt im 20. Jahrhundert erschütterten.
Schon etwas früher tauchten in Russland interessante philosophi sche und religiöse Konzepte auf, und die Zeit des frühen 20. Jahrhun derts wurde in der Forschungsliteratur als philosophisch-religiöse Re naissance bezeichnet. Als Begründer dieser Denkströmung, die mit der Rückkehr der Religion in den Kontext der Philosophie verbunden ist, wird gewöhnlich W. S. Solowjew angesehen, dessen Ideen in der einen oder anderen Form einen ziemlich starken Einfluss auf russische Denker hatten, insbesondere auf E. N. Trubezkoi, S. S. Trubezkoi, S. N. Bulgakow, P. A. Florenski, W. F. Ern, W. P. Swentsitski, N. A. Berdjaew, L. I. Schestow, S. L. Frank, W. W. Rosanow, [und] Schrift steller [wie] D. I. Mereschkowski und S. N. Hippius. Die Atmosphäre [wörtl.: Der Geschmack] des Silbernen Zeitalters prägte jedoch auch die geistige Suche der russischen Denker. Das Konzept eines „neuen religiösen Bewusstseins“, der Wunsch, das Christentum neu zu in terpretieren und die Kirche zu erneuern, wurde von den russischen Philosophen der Moderne oft mit der deutschen Mystik, der Theoso phie, der Anthroposophie, der Hinwendung zu sektiererischen Ideen (insbesondere zum Chlystentum), mit ihren erotischen Untertönen und der Einbeziehung des „fleischlichen Menschen“ in den religiö sen Kontext verbunden. Vor dem Hintergrund dieser geistigen Suche russischer religiöser Denker wirkte Iwan Iljin, der als orthodoxester christlicher Denker weit entfernt von dieser Art von Mystizismus war und seine akademische Ausbildung an der juristischen Fakultät der Kaiserlichen Moskauer Universität erhielt, wie eine „weiße Krähe“. Besuche in philosophischen Zirkeln und Versammlungen, bei denen der junge Denker A. Bely, Wjatscheslaw Iwanow, N. A. Berdjaew, W. F. Ern, S. N. Bulgakow kennenlernte, riefen bei Iljin Empörung hervor, und viele seiner Zeitgenossen zählte der Philosoph zu denen, derent wegen die Philosophie weiterhin in der Krise steckt.
Ein charakteristisches Merkmal, das Iljin von vielen russischen religiösen Denkern unterscheidet, ist die Betonung des psychologi schen Aspekts und seiner Rolle im geistigen Leben des Individuums und im Prozess der Erkenntnis. Der Durchbruch, den die Psychologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebte, konnte von den Vertretern der sozial-humanitären Wissenschaften nicht unbemerkt bleiben. In Russland gab es sogar eine ganze Richtung in der Soziologie und Rechtswissenschaft (Rechtsphilosophie), die sich mit der Entwicklung der psychologischen Theorie des Rechtsbewusstseins beschäftigte (L. I. Petraschitski). Iwan Iljin gehörte zur Schule der wiederbelebten, vor allem im Rahmen der Moskauer Rechtsschule vertretenen Naturrechtstheorie, die von seinem Lehrer P. I. Nowgorodzew geleitet wurde. Die Schule von Nowgorodzew zeichnete sich durch ein gu tes Niveau der historischen und philosophischen Ausbildung aus, so dass sich die Studien der Juristen dieser Schule in wissenschaftlichem Niveau und Darstellungsweise kaum von denen der Absolventen der historischen und philologischen (philosophischen) Fakultät unter schieden. Es ist erwähnenswert, dass der damals junge Iljin während seines Magisterstudiums seinen Lebensunterhalt mit dem Verfassen von Rezensionen und Artikeln, mit Übersetzungen von Büchern wie Der Anarchismus von P. Eltzbacher und Über soziale Differenzierung von G. Simmel aus dem Deutschen ins Russische sowie mit Nachhil feunterricht und Lehrtätigkeit verdiente. In diesem Zusammenhang verfolgte der Philosoph aufmerksam alle Neuerungen in Recht, Philo sophie, Psychologie und Soziologie (Sozialphilosophie/Psychologie). Schon früh zeigte sich Iljins Interesse an geistigen Fragen und eine deutliche Neigung zu einem religiös-philosophischen Verständnis all dieser Disziplinen, die er in seinem umfangreichen philosophischen Schaffen weiterentwickelte.
So kann man in seinem frühen Artikel „Über die Höflichkeit“ (1912) Spuren des Einflusses von G. Simmels Konzepten erkennen, oder vielmehr einen Versuch, in Analogie zu dem Artikel „Die Gesel ligkeit“ des deutschen Denkers eine solche Form der Kommunikati on wie die „Höflichkeit“ durch das Lust-Unlust-Prinzip von S. Freud zu betrachten, das er in seiner Publikation „Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens“ dargelegt hat. Laut einer Aussage von Iljins Zeitgenossen besuchte der Philosoph Freud sogar einmal persönlich, als er 1914 auf einer Geschäftsreise in Wien war. Der Artikel „Über die Höflichkeit“ war der Versuch, ein interessantes sozialpsychologisches Konzept zu entwerfen, das die Regeln der Höf lichkeit als soziale Formen der Mindestliebe (Empathie) erklärt, die wir unserem Gesprächspartner als Nachbarn entgegenbringen sollten. Iljin kam jedoch schon früh zu dem Schluss, dass die rein äußerliche, formale Höflichkeit, wenn sie nicht von einem wirklich liebevollen Gefühl für den Gesprächspartner genährt wird, mit Interesse an ihm und unter Berücksichtigung seiner Individualität, zu einer leeren Form wird, die für alle gleich ist, ja sogar zur Vulgarität wird. In diesem Zu sammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Kapitel „Der religiöse Sinn der Vulgarität“ in den Axiomen ursprünglich als Fort setzung des früheren Artikels „Über die Höflichkeit“ konzipiert und ausgeführt wurde. Mit Vulgarität, nicht im abgedroschenen Sinne des Wortes, meinte der Philosoph jenen Zustand, in dem der Mensch sich bewusst von Gott entfernt und das Göttliche nicht mehr wahrnimmt, die Möglichkeit der Existenz von etwas Vollkommenerem ignoriert und ablehnt. Wir können sagen, dass das Abgleiten in den Zustand der Vulgarität im direkten Zusammenhang mit dem Verlust des sakralen Kerns im geistigen Leben des Menschen steht. Anders ausgedrückt: Wenn ein gläubiger Mensch dazu neigt, Wunder und Geheimnisse selbst in den einfachen Dingen der ihn umgebenden Welt zu entde cken, leugnet ein religiös toter Mensch diese Spuren des Göttlichen in der Welt, indem er eine bequeme Erklärung für sie findet.
Bei der Lektüre der frühen Artikel-Reden des Philosophen [2], die später Teil der Sammlung Die religiöse Bedeutung der Philosophie: drei Reden 1914 – 1923 [3] wurden (auf dieses Buch bezieht sich Iljin in den Axiomen wiederholt), erinnert man sich nicht nur an den frühen He gel, dem der Philosoph seine grundlegende Studie Die Philosophie He gels als Lehre von der Konkretheit Gottes und des Menschen widmete, sondern auch an das Werk von W. James Die Vielfalt religiöser Erfah rung. Es ist anzunehmen, dass sich der Leser beim Blick auf den Titel des Buches des russischen Denkers, dem dieses Vorwort gewidmet ist, bereits an dieses Werk von James erinnert hat. Die Bekanntschaft mit der „Religionspsychologie“ des amerikanischen Forschers fand höchstwahrscheinlich in Russland statt, denn 1910 war James‘ Buch bereits ins Russische übersetzt worden. Es sei daran erinnert, dass die Axiome im Projekt den Titel Philosophie der Religion trugen, und es scheint, dass Iljin, der sich einst für Simmels Ansatz zur Geselligkeit interessierte, die „Höflichkeit“ auf recht originelle Weise analysierte. So unternimmt der russische Philosoph, der sich für den Forschungs ansatz von James interessiert, den kolossalen Versuch, eine philo sophische Analyse der religiösen Erfahrung vorzunehmen und ihre universellen Axiome abzuleiten. Abgesehen von einer allgemeinen Fragestellung, die mit einer bedachten Reaktion auf die Dominanz des positivistischen Ansatzes in den Geisteswissenschaften verbunden ist, den James als „medizinischen Materialismus“ bezeichnet, teilen Iljin und der amerikanische Psychologe die Ansicht, dass die Vielfalt der Formen religiöser Erfahrung keineswegs ein Beweis für das Scheitern des religiösen Glaubens als solchem ist. Diese These ist angesichts des gegenwärtigen Zustands des religiösen Bewusstseins heute äußerst re levant.
Der Schlüsselbegriff, den Iljin hier verwendet, ist der Begriff „Reli giosität“, der nicht nur auf den Seiten der Axiome auftaucht, sondern auch in seinen Werken wie Über das Wesen des Rechtsbewusstseins [4], Der Weg zur Evidenz und Der Weg der geistigen Erneuerung. Seiner Ansicht nach kann „Religiosität“ nicht auf den Begriff „Religion“ im traditionellen Sinne reduziert werden. Religiosität kann als das Ergeb nis der Interaktion mit dem Gegenstand betrachtet werden, der bei einer Person ein Gefühl der geistigen Erhebung, des Glücks und der Ehrfurcht hervorruft. Es gibt keine unreligiösen Menschen, alle Men schen sind religiös, aber der Gegenstand ihrer Religiosität kann sich sehr vom Glauben an Gott unterscheiden. Die Religiosität, die durch etwas viel Niedrigeres als die Spiegelungen des Göttlichen in einer wahrhaft gläubigen Seele verursacht wird, nennt Iljin „nicht geistig“. In den literarischen Ergänzungen zum zweiten Kapitel der Axiome stellt der Philosoph fest: „Im Durst nach Vollkommenheit (Gott) und Vervollkommnung (Frömmigkeit) sehe ich die wesentliche Quelle der geistigen Religiosität, und die nicht geistige Religiosität hat immer an dere, weniger hohe und edle Quellen gehabt und wird immer andere haben.“ In einer frühen Rezension von Schleiermachers Buch Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern betont Iljin, dass Schleiermacher aus der Position eines Philosophen-Forschers heraus alle Erscheinungsformen von Religiosität als gleichwertig an erkennt, dass es aber eine solche Anerkennung von Seiten des Gläubi gen, der von seiner eigenen religiösen Erfahrung besessen ist, nicht ge ben kann – daher besteht die Aufgabe der Religionsphilosophie darin, den richtigen Weg zu finden, um die Positionen des Philosophen und die Position des Gläubigen miteinander zu versöhnen. Nachdem Iljin einen solchen Weg für die Religionsphilosophie skizziert hat, versucht er selbst, diese Versöhnung herbeizuführen, indem er die Kriterien der geistigen, wahren Religiosität einführt und auf die Existenz einer „re ligiösen Methode“ hinweist, mit der wir die Evidenz des Gegenstands erreichen können. Auf den Seiten der Axiome wird der russische Philosoph über Schleiermacher als einen Denker schreiben, der die Möglichkeit einer wahren „religiösen Methode“ verneint hat, und er betont: „Die Religiosität ist ohne den Aufbau der religiösen Erfahrung unmöglich. Sie ist vor allem die aktive und organisierte Läuterung des individuellen Geistes in seiner Ausrichtung auf Gott“ (S. 187) [5].
Schon während seines Studiums an der Kaiserlichen Moskauer Universität war Iljin sehr besorgt über die Krise, die sich in der Philosophie und damit in allen Geisteswissenschaften abzeichnete. Sein In teresse an Hegel, das nach der Lektüre der Phänomenologie des Geistes geweckt wurde, seine Vorliebe für die Methode von E. Husserl, dessen Seminare der Philosoph 1911 in Deutschland besuchte, waren mit der damaligen Suche nach einem Ausweg aus der tiefsten Krise des phi losophischen Denkens verbunden. Iljin verstand die Phänomenolo gie Husserls jedoch nicht als ein neues Wort in der Philosophie – der Denker fand die Anwendung der phänomenologischen Methode bei den Philosophen der Antike und den Ostkirchenvätern.
Besonderes Augenmerk legt Iljin auf den Begriff „Erfahrung“, der im Zeitalter der Dominanz des Positivismus in der Philosophie in der Regel nur mit empirischer Erfahrung in Verbindung gebracht wurde. Die Kategorie „individuelle geistige Erfahrung“, die uns auf den Seiten der Axiome immer wieder begegnet, impliziert dagegen sowohl den Prozess als auch das Ergebnis der menschlichen Erkenntnis von nicht materiellen, übersinnlichen Dingen, Gegenständen. Niemand kann jemals einem anderen genau seine eigenen „geistigen Erfahrungen“ vermitteln, daher sind sie immer zutiefst persönlich und subjektiv. Doch das bedeutet keineswegs „unobjektiv“ im Sinne von „nur meine Meinung“, sondern sie haben einen Zugang zur Wahrheit. Vielleicht ist das der Grund, warum einige „Gottsucher“ wie N. A. Berdjajew, F. A. Stepun, A. D. Obolenskij Iljins Reden hörten, in denen er die Notwendigkeit der Reformation in Bezug auf den persönlichen Glau ben, den persönlichen Aspekt des Glaubens, betonte: „Mein Glaube ist nicht dein Glaube“ – verwirrt waren, Iljin als Protestant einstuften und ihm Unglauben vorwarfen.
Die im Wesentlichen christliche Anthropologie dieses russischen Philosophen ist durch dasselbe gekennzeichnet wie die orthodo xe Askese – Iljin verweist auf die dreiteilige Zusammensetzung des menschlichen Wesens: Körper, Seele, Geist – und jede dieser drei Komponenten impliziert eine entsprechende Art von Erfahrung. Wir können materielle oder immaterielle (geistige) Gegenstände aufgrund der Tatsache erkennen, dass wir ein entsprechendes „Erkenntnisor gan“ besitzen, das eine vorherige „Einstimmung“ erfordert. In einem frühen Artikel „Philosophie als geistiges Schaffen“ versucht Iljin, die Methode der Philosophie zu rechtfertigen und darauf hinzuweisen, dass Philosophie zu betreiben bedeutet, die eigene geistige Erfahrung zu kultivieren und ihr einen Sinn zu geben, indem man den blinden Instinkt, das psychische „Mein Weg“, „Ich will“ und „das Angeneh me“ reduziert. Schon der Vergleich der Philosophie mit „geistigem Schaffen“ verweist uns auf die asketische Tradition der Orthodoxie, in der das „geistige Schaffen“ als eine besondere Methode der Gotteser kenntnis verstanden wird und die Erfahrung der Gotteserkenntnis für jeden Asketen oder Heiligen zutiefst persönlich ist, worauf Iljin in sei nen Axiomen immer wieder aufmerksam macht. „Geistige Nüchtern heit“ bedeutet im weitesten Sinne des Wortes die Beherrschung von Einbildungskraft, Instinkt, Gefühl, Wille, die neben dem Verstand und dem Herzen ebenfalls in den Erkenntnisprozess einbezogen sind, aber geläutert werden müssen, um den Gegenstand richtig wahrneh men zu können. Gleichzeitig unterscheidet sich der Begriff der „Ver nunft“ von der separaten und neuzeitlich gehobenen menschlichen Eigenschaft des logisierenden Verstandes, indem die nicht säkular ori entierte Vernunft „gegenständlich aus der geistigen Erfahrung heraus betrachtet“ wird.
Die Möglichkeit, Objektivität, Wahrheit durch persönliche Erfah rung zu erreichen, wird durch Iljins philosophischen Begriff „Gegen ständlichkeit“ bedingt, der, wie einige russische Forscher zu Recht festgestellt haben, durchaus mit E. Husserls Kategorie des „Intentio nalität“ vergleichbar sein kann. Der Unterschied zwischen Iljins Kon zept und Husserls phänomenologischer Position besteht jedoch darin, dass Iljin nicht nur an der intentionalen Ausrichtung und Konzent ration des Bewusstseins auf den Gegenstand interessiert ist, sondern auch an der Fähigkeit, das Wichtigste und Wesentlichste im Gegen stand, sein Wesen, zu erkennen, wenn man sich an Gott und nicht an sein eigenes Ich wendet. Man kann sogar sagen, dass der Philosoph unter „Gegenständlichkeit“ die philosophische Operation der getreu en, angemessenen Entdeckung des göttlichen Plans des Gegenstands in sich selbst durch individuelle Prüfung, durch Aufnahme eben dieses Gegenstands in die eigene Seele versteht. Mit anderen Worten, es ist notwendig, ihn (den Gegenstand) zu analysieren, geläutert von willkürlichen subjektiv-psychischen Zusätzen, d. h. von dem, was „ich gerne sehen würde“. Der in die „Seele“ [6] aufgenommene Gegenstand muss „über sich selbst sprechen“. Philosophie und Religion, so der Denker, arbeiten mit dem, was er als „geistige Erfahrung“ bezeichnet. In dieser Hinsicht ist die wahre Philosophie in ihrem Wesen bereits Religion und umgekehrt. Die unter einem gemeinsamen Titel veröf fentlichten Artikel (Die religiöse Bedeutung der Philosophie: drei Reden 1914-1923) sind durch Iljins Hinweis verbunden, dass die geistige Er fahrung, mit der Priester, Künstler und Philosophen arbeiten müssen (sonst entsprechen sie nicht ihrem Titel), unmittelbar eine religiöse Erfahrung ist, die einer ständigen Überprüfung (religiöser Zweifel) und Läuterung bedarf.
In Bezug auf die Frage der religiösen Autonomie und Heterono mie, die Hegel seinerzeit Schwierigkeiten bereitete, betont Iljin, dass die Autonomie des Subjekts eine unverzichtbare Bedingung auf dem Weg des geistigen Wachstums ist, aber sie verhindert nicht die an fängliche Akzeptanz der Postulate der religiösen Autoritäten, die durch persönliche Erfahrung geprüft werden müssen. Gleichzeitig bedeutet die Autonomie keinen Bruch mit der Kirche, die ihre be sonderen Gaben in das Leben des Suchenden nach wahrer religiöser Erfahrung einbringt, sondern jenes obligatorische Mindestmaß an Freiheit bietet, das für die Kultivierung eines geistigen Lebens, eines eigenen religiösen Inhalts, notwendig ist, der nach einer unmittelba ren Wahrnehmung des Gegenstands streben muss. „Subjektivität“ und „Autonomie“ sind die beiden Säulen der wahren Religiosität; die „religiöse Ganzheitlichheit“ der geistigen Erfahrung (einschließlich Herz, Instinkt, Gewissen, Wille), die „religiöse Aufrichtigkeit“, die die Herausbildung eines religiösen Charakters im Menschen voraussetzt, in dem das ganze Leben mit seinem Glauben in Einklang gebracht wird und der Mensch in jeder Schwierigkeit des Lebens „die Feuer des individuellen Lebens“ zu sehen lernt – dies alles zusammen bildet das, was man nach Iljin „die Axiome der religiösen Erfahrung“ oder „die Anthropologie des Glaubens“ nennen könnte.
Über die untrennbare Verbindung zwischen geistiger Erfahrung und Charisma, Hierarchie (göttlich-menschlich) und die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte: In diesem Zusammenhang taucht das Konzept des „geistigen Ranges“ in der einen oder anderen Weise in einer Reihe von Werken des russischen Denkers auf und geht auf einige der Ideen zurück, die von T. Carlyle in seinem Buch On He roes, and Hero-Worship, and the Heroic in History skizziert wurden, was heutzutage falsch interpretiert wird. Es ist anzumerken, dass das vorrevolutionäre russische sozialphilosophische und soziologische Denken auch dadurch gekennzeichnet war, dass es mehr oder weniger die Rolle einzelner Persönlichkeiten anerkannte, die den Lauf der Ge schichte veränderten und die Menschen zu großen Taten und Leistun gen im Namen der Verwirklichung hoher, entwickelter sozialer und moralischer Ideale anregten (die Konzepte von N. K. Michailowski, P. L. Lawrow, P. I. Nowgorodzew und sogar G. W. Plechanow). Sol che Menschen kann man als Genies in dem Bereich bezeichnen, in dem sie sich bewährt haben. Nach Iljin besteht ein großer Unterschied zwischen einem Genie, das sich fast ständig im geistigen Pleroma [griech.: πλήρωμα (pléroma) –„Fülle“] befindet, und einem begabten Menschen. Dabei können die Ansätze des Genies in jedem Menschen schlummern, und nur bei einigen Menschen manifestieren sie sich deutlich über ihren Willen und ihre Bemühungen hinaus. Ein Genie ist unfähig, Schurkerei zu begehen, obwohl es nicht frei von Sünde ist, weil seine geistige Erfahrung wahrhaft religiös ist; ein begabter Mensch kann leicht ins Vulgäre abrutschen, wenn der Mensch nur auf der Seelenebene verhaftet ist. Denn nach Iljin ist Talent eine Eigen schaft, die eher der Seele als dem Geist eigen ist. Oft wächst das Talent nicht auf die geistige Ebene hinauf und entwickelt sich nicht zum Genie, weil der Sinn für das Göttliche im Bewusstsein des Menschen unzureichend ist, was bei einem genialen Menschen das Verantwor tungsgefühl für seinen Dienst und ein wachsames Gewissen fördert. Solche, auf diesen Gefühlen basierenden Gedanken und Handlungen eines Genies können andere Menschen nicht gleichgültig lassen, – die Handlungen eines Genies erwecken unsichtbar religiös lebende Seelen und helfen ihnen selbst, den Weg wahrer Religiosität zu gehen. Der Begriff des „geistigen Ranges“ stellt die Grundlage der Religiosität dar und impliziert, dass der Mensch das verehrt, was vollkommener ist und über seinen natürlichen Begrenzungen im geistigen Sinne steht – er wird dem höchsten Gegenstand, Gott, unterworfen. Ausgehend von dieser Erkenntnis der eigenen Unbedeutsamkeit in der Welt kann der Weg zum Erwerb religiöser Erfahrungen erst beginnen, der den indi viduellen Geist entzündet und den Menschen auf den Weg der stän digen Selbstvervollkommnung führt. So entfalten sich nach Iljin die Axiome der religiösen Erfahrung auf einer sozio-historischen Ebene.
„Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber andere wissen es auch nicht“ – so soll laut Platon der große Weise Sokrates über sich selbst gesagt haben, der glaubte, dass Tugend nur durch persönliche Erfahrung erlernt werden kann. Iljin war sich seiner Grenzen bewusst, und so nannte er sich im Gegensatz zu einigen seiner „unwissenden“ Zeit genossen nie „Theo-σοφ“ [griech.: „θεός“ (Theos) – Gott, „σοφός“ (sophos) – weise, also: „Theo-σοφ»“, „Gottesweiser“], sondern zog es vor, „Theo-mōrē“ [griech.: „μωρός“ (moros) – „töricht“, also: „Theo mōrē“, „Gottestörichter“] zu sein. Es ist dieser Geist der asketischen Bescheidenheit, der seine Studie durchdringt, und es lohnt sich, sich anhand des Vorworts des Autors damit vertraut zu machen.
Alexandra Vakulinskaja
[1] Es gelang nicht sofort, die Arbeit zu veröffentlichen. Ursprünglich hatte Iljin nach langem, schwerem Nachdenken auf Empfehlung des Oberhaupts der Russischen Auslandskirche, Vater Anastasius (Gribanowski), das Manuskript an den Verlag YMCA-Press geschickt, mit dem einige russische Denker, die den ökumenischen Ideen positiv gegenüberstanden, eng zusammenarbeiteten (zum Beispiel Mutter Maria (Skobtsova), N. A. Berdjajew, W. N. Iljin, B. P. Wyscheslawtsew und andere). Nachdem jedoch die Veröffentlichung abgelehnt wurde, atmete Iwan Iljin erleichtert auf, da seine Gewissensqualen gelöst waren. Nach Vermutungen des Theologen und Historikers der russischen Kirche, A. W. Kartaschew, mit dem Iljin in Kontakt stand, lehnte YMCA-Press den Philosophen nicht nach der Lektüre des Buches ab, sondern lediglich aufgrund der Tatsache, dass Iljins Ruf als Philosoph durch Verleumdungen von N. A. Berdjajew (der zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war) beschädigt war. Wie durch ein Wunder wurde Iljins zweibändige Untersuchung dank des Engagements des russischen Mäzens W. P. Rjabuschinski veröffentlicht.
[2] „Philosophie als geistiges Schaffen“ (1914), „Philosophie und Leben“ (1918), „Über die Wiederbelebung der philosophischen Erfahrung“ (1923).
[3] Das Buch erschien 1925 dank der Hilfe des Philosophen N. A. Berdjajew in der YMCA-Presse; finanzielle Schwierigkeiten zwangen I. A. Iljin, sein Material an ei nen ökumenischen Verlag abzugeben, den der Philosoph mit Misstrauen betrachtete. [Deutsche Übersetzung o. O., 2025; A. K.].
[4] Tatsächlich wurde dieses Buch 1919 in Moskau im Wesentlichen fertig gestellt, aber wegen des bolschewistischen Putsches in Russland wurden nur die ersten zehn Kapi tel in der Druckerei der Rjabuschinskis veröffentlicht.
[5] In I. A. Iljin, Die Axiome der religiösen Erfahrung, Moskau, 2002 (http://www.odinbla go.ru/filosofiya/ilin/ilin_aksiomi/) – die Vorlage der vorliegenden Übersetzung des Buchs.
[6] Hier impliziert dieser Begriff neben dem Bewusstsein (der Vernunft) die Einbezie hung des Herzens, der Vorstellungskraft, des Willens und des Instinkts in den Prozess des Erkennens.
Mit dieser ersten deutschen Ausgabe von Iwan Iljins Philosophie der Religion: Die Axiome der religiösen Erfahrung wird keine philologisch kritische, aber doch eine editorisch erschlossene und kommentierte Ausga be angestrebt. Der Herausgeber, ein Schriftsteller, Publizist und habilitierter Arzt, der auch einige Jahre Philosophie studiert hat, regte im April 2018 die Ausgabe an, weil er eine wissenschaftliche, po litische und moralische Notwendigkeit für eine Edition dieses Haupt werks des russischen Philosophen sah. Der erfahrene Übersetzer Sascha Rudenko, der bereits Iljins Meisterwerk Über den gewaltsamen Widerstand gegen das Böse übersetzt hat, ist ein mehrsprachiger Philosoph und Philologe; die Übersetzung wurde im Februar 2023 fertig. Der fertige Text wurde dann mehrfach vom Herausgeber lektoriert und korrigiert. Persönliche Veränderungen freudiger und trauriger Art bei beiden Beteiligten, die zudem voll im Beruf standen, haben zu Verzögerungen geführt, ohne dass das Ziel aus den Augen verloren wurde, welches nun als vom Verlag Philosophia Eurasia den Leserin nen und Lesern in ansprechender Form ausgestattetes Buch vorgelegt werden kann. Es ist mit erhellenden Texten zweier russischer Autoren ergänzt: Das Vorwort (von Prof. Dr. Denis Jdanoff, Heilbronn) und die Einleitung (von Dr. Alexandra I. Vakulinskaya, Moskau) wurden eigens für diese Ausgabe geschrieben. Der Herausgeber hat ein Nach wort beigesteuert.
Dieses zu seinen letzten zählende Werk Iljins, an dem er über 30 Jah re gearbeitet hatte, erschien unter dem Titel Аксиомы религиозного опыта: Исследование (Aksiomy religioznago opyta: Izsledovaniye = Die Axiome der religiösen Erfahrung: Eine Studie) 1953 in zwei Bän den bei der Imprimerie de Navarre in Paris. Die vorliegende Überset zung folgt der russischen Ausgabe Аксиомы религиозного опыта (Aksiomy religioznogo opyta = Die Axiome der religiösen Erfahrung), Москва: Издательство АСТ (Moskva: Izdatelstvo AST = Moskau: Verlag AST) 2002, die auch online seitenidentisch einsehbar ist (http:// www.odinblago.ru/filosofiya/ilin/ilin_aksiomi/). Die Seitenzahlen dieser russischen Ausgabe wurden in eckigen Klammern im Fließtext eingefügt; alle Verweise der beigefügten Verzeichnisse beziehen sich auf diese Seitenzahlen.
Die verwendete russische Ausgabe enthält leider nicht die in der Erstausgabe enthaltenen „Literarischen Ergänzungen“ zu jedem Kapi tel des Buches. Der Umfang der deutschen Ausgabe wäre andernfalls allerdings über das vertretbare Maß hinaus angewachsen. Eine Über setzung dieser „Ergänzungen“ bleibt eine Aufgabe der Zukunft.
Iljin wollte dieses Buch selbst noch auf Deutsch veröffentlichen (diesen Hinweis verdanke ich Frau Dr. Alexandra Vakulinskaya). 2024 wurde das digitalisierte Archiv seines Nachlasses online ge stellt (https://www.culture.ru/catalog/archiv_ilina/ru/item/books); dort findet sich auch eine nicht mehr vollständig von ihm korrigierte deutsche Übersetzung der Axiome, die an vielen Stellen als Korrek tur des russischen Textes gelesen werden kann. Ein vom Herausgeber durchgeführter Vergleich beider Übersetzungen bestätigte die hohe Qualität der vorliegenden sprachlich moderneren Übersetzung und berücksichtigte Iljins Formulierungen, wo immer es sinnvoll schien, als in eckigen Klammern aufgeführte Alternativen. Deutsche Hinzu fügungen Iljins zum übersetzten russischen Text wurden besonders gekennzeichnet. Nicht übernommen wurden Hervorhebungen durch Sperrung oder Unterstreichung. Iljins Übersetzung ist damit in der vorliegenden „aufgehoben“. Übrigens fehlen einige Absätze in Iljins deutschem Manuskript, sodass die vorliegende Übersetzung die voll ständigste Ausgabe des Werkes überhaupt sein dürfte.
Der Haupttitel der deutschen Ausgabe lautet Philosophie der Religion, weil Iljin selbst ursprünglich diesen Titel für das Werk vor gesehen hatte (auch diesen Hinweis verdanke ich Frau Dr. Alexan dra Vakulinskaya); er passt und ist prägnanter. Bei der Übersetzung wurde bei möglichster Konsequenz bei den Begriffen auf wörtliche Genauigkeit Wert gelegt; Iwan Iljins bildhaft-saftiger sprachlicher Gout wurde, wie wir meinen, in dieser, wie schon bei der oben er wähnten, Übersetzung gut getroffen. Dazu gehören auch die unge wöhnlichen Zusammensetzungen von Adjektiven wie beispielsweise „naiv-unmittelbar“ oder von Substantiven, bei denen auf die Groß schreibung des zweiten verzichtet wurde, da sie wie ein Wort wirken sollen.
Auch die Zeichensetzung, besonders die Verwendung von Gedan kenstrichen und Kommata, entspricht nicht immer den deutschen Regeln; um aber den rednerischen Duktus Iljins zu bewahren, wurden diese Besonderheiten beibehalten, zumal das Verständnis dadurch unseres Erachtens nicht etwa behindert, sondern gefördert wird. So genannte Auslassungspunkte verwendet Iljin häufig am Satzende, nicht eigentlich, um Text auszulassen, sondern um eine nachdenkli che Pause anzudeuten. Anführungszeichen verwendet er häufig nicht zur Kennzeichnung von Zitaten, sondern um Worten – ebenfalls rhe torisch – einen anderen (z. B. metaphorischen oder ironischen) Sinn unterzulegen. Die Übersetzung der tatsächlichen Zitate erfolgte direkt aus dem russischen Text und unterscheidet sich daher von etwaigen bereits existierenden Übersetzungen. Wörter, die Iljin entgegen der russischen Rechtschreibung mit großem Anfangsbuchstaben schreibt, etwa weil das betreffende Wort etwas Göttliches, Heiliges oder beson ders Wichtiges kennzeichnen soll, erscheinen in der Übersetzung in Kapitälchen. Namen eigenständig gedruckt veröffentlichter Wer ke oder Zeitschriften werden grundsätzlich kursiv geschrieben, Titel von Werkteilen, Artikeln u. Ä. stehen überall in Anführungszeichen. Russische, chinesische und andere, im Original nicht in lateinischer Schrift geschriebene, Namen und Begriffe werden nicht in der offizi ellen wissenschaftlichen Transkription, sondern traditionell geschrie ben. Die manchmal abweichende Schreibung dieser Namen durch die Autoren von Vorwort und Einleitung wurde nicht vereinheitlicht. La teinische Zitate werden kursiv geschrieben.
Die Ergänzungen des Übersetzers und des Herausgebers im Fließ text (z. B. Übersetzungsalternativen) und die zahlreichen Kommen tare von Übersetzer und Herausgeber in den Fußnoten sollen dem besseren Verständnis dienen, stehen in eckigen Klammern und sind (in den Fußnoten) mit den jeweiligen Initialen gekennzeichnet. Für die Kommentare wurden religionswissenschaftliche Standardwerke in neuester Auflage benutzt. In den eigenen Fußnoten Iljins erfolgte nur bei unvollständiger und uneinheitlicher Zitierweise (Namen mit oder ohne Vornamen, Werktitel mit und ohne Anführungszeichen, Erscheinungsort oder Publikationsjahr) eine bibliographische Kor rektur, Ergänzung oder Vereinheitlichung in eckigen Klammern mit den Herausgeber-Initialen gekennzeichnet; Iljins Zitate mit Autor- und Werktitelnennung im Fließtext wurden so belassen. Die vom Herausgeber ermittelten bibliographischen Angaben der zitierten Bücher (Erscheinungsort, -jahr) sowie das Jahr der Entstehung von zitierten Gedichten und Werken der bildenden Kunst finden sich bei der jeweils ersten Erwähnung immer in den Fußnoten.
Im Personen- und Literaturverzeichnis sind alle von Iljin im Fließ text und den Fußnoten erwähnten Personen und Werke der Literatur und der bildenden Kunst alphabetisch und mit den Seiten der Erwäh nung aufgeführt, soweit sich Iljin direkt oder indirekt auf sie bezogen hat. Die bloße Erwähnung eines Jupiter-Tempels führt zum Beispiel nicht zur Aufnahme des Lemmas „Jupiter“ im Verzeichnis, weil es um den Tempel geht; ebenso werden Werke, die der Herausgeber in seinen Kommentaren erwähnt, nicht aufgenommen. Bringt Iljin nur ein Zitat aus einem Text, ohne Autor oder Titel zu nennen, oder er wähnt er ein Werk mit seinem Titel, ohne den Autor anzugeben, oder nennt er eine fiktive Figur ohne Nennung des Autors oder des Werks, in dem sie auftritt, wurden Autor und Werktitel mit bibliographischen Angaben (wie immer) vom Herausgeber für die Fußnoten ermittelt, aber im Verzeichnis die Seite der erfolgten indirekten Erwähnung des Werks oder der Name des indirekt angeführten Autors jeweils durch eckige Klammern gekennzeichnet. Zitate, die nur aus einem oder zwei unspezifischen Worten bestehen, konnten nicht immer nachgewiesen werden.
Bei den historischen Personen werden im Verzeichnis neben dem vollen Namen auch die Lebensdaten aufgeführt, Werktitel werden im Verzeichnis ohne Bibliographie aufgeführt, bei Kunstwerken al lerdings mit Gattungsbezeichnung. Zur schnellen Orientierung die nende Anmerkungen zu wenig bekannten Namen erfolgten im Ver zeichnis sparsam, denn ein interessierter Leser wird im Zeitalter der Suchmaschinen leicht fündig.
Bei einigen Zitaten „heidnischer“ antiker Autoren hat Iljin zwar den jeweiligen Autor erwähnt, aber keine Quelle nachgewiesen, so dass nicht bekannt ist, aus welcher russischen Ausgabe er zitiert. Auch wenn die Textstelle bei „heidnisch“-antiken Autoren in einer deutschen Übersetzung nachgewiesen werden konnte, wurde nur der Titel des Werks ohne die (letztlich beliebige) Bibliographie einer der deutschen Ausgaben in den Fußnoten angegeben. Ausnahme bilden Vorsokratiker, für die der Diels/Kranz in der Ausgabe von 1951 bean sprucht wurde. Bei den Kirchen- und Wüstenvätern wurde die (aus dem Griechischen übersetzte) Philokalie der heiligen Väter der Nüch ternheit aus dem Beuroner Kunstverlag, 2016, herangezogen, denn in den Fällen, in denen Iljin die Quelle eines Kirchenvater-Zitats angibt, ist sie häufig, aber nicht immer die Philokalie in der russischen Über setzung Theophans des Klausners, die selbst auch eine (allerdings im Vergleich zur griechischen Version wesentlich größere) Sammlung von Texten der Kirchenväter ist. Sie hat als solche keine deutsche Übersetzung erfahren, weshalb Nachweise Iljins aus der russischen Philokalie belassen wurden. In den restlichen Fällen gelang der Quel lenfund überwiegend mit Hilfe der Bibliothek der Kirchenväter (Kösel Verlag).
Bei zitierten Versen russischer Gedichte wurde ebenfalls nie eine bereits vorhandene formgetreue Übersetzung herangezogen, weil der Sinn, auf den Iljin abhebt, in den Übersetzungen regelmäßig verloren geht. Daher werden die Verse wörtlich übersetzt gebracht.
Zitate aus der Bibel werden gleichfalls direkt aus dem Russischen übersetzt und nicht etwa einer Formulierung aus einer der vielen deutschen Bibel-Ausgaben angepasst. Die von Iljin angeführten oder bei Zitaten vom Übersetzer und Herausgeber ermittelten Bibelstel len sind vom Herausgeber in einem Schriftstellenverzeichnis erfasst worden. Bereits im Fließtext sind unvollständige Stellenangaben mit der Komplettierung in eckigen Klammern ergänzt und offensichtlich falsche mit der Korrektur versehen worden; nur die korrekten Stellen angaben finden sich im Verzeichnis.
Der Herausgeber ist sich gewisser trotz aller Sorgfalt immer noch vorhandenen Schwächen dieser Ausgabe bewusst und hofft, dass sie später einmal beseitigt werden. Er ist aber zuversichtlich, dass sie ei ner gewinnbringenden Lektüre nicht im Wege stehen.
Adorján Kovács